Die Chamäleon-Kraft in der Promotionsphase – KI nutzen, ohne unsichtbar zu werden
Ein Beitrag zur Blogparade #kAIneEntwertung von Dr. Anika Limburg und Joscha Falck
TL;DR Promovierende befinden sich durch die Diskussionen über die Zulässigkeit der KI-Nutzung in einer besonders herausfordernden Situation. Sie benötigen die Stärke eines wissenschaftlichen Chamäleons, das sich anpassen kann, ohne gänzlich unsichtbar zu werden.
KI fordert die Hochschulen heraus, auch im Oktober 2025 noch, obwohl schon fast drei Jahre seit Beginn des Hypes vergangen sind. Insbesondere das wissenschaftliche Arbeiten ist betroffen, das nun vermeintlich „mit einem Klick“ erledigt werden kann und somit die so genannte Eigenleistung in den Hintergrund tritt.
Die Herausforderungen, die für Studierende und Lehrende entstanden sind, wurden bereits und werden weiterhin hinlänglich beschrieben. Auch ein Austausch über die Chancen und neuen Möglichkeiten findet glücklicherweise statt. Eine Gruppe von Hochschulangehörigen jedoch befindet sich in einer besonders herausfordernden Situation, die kaum thematisiert wird, und das sind Promovierende. Ihnen wird gerade viel abverlangt.
Die besondere Situation von Promovierenden
Zunächst: Promovierende forschen und lehren zudem in vielen Fällen auch. Sie sind demnach doppelt von den Veränderungen durch KI in ihrer Arbeit betroffen. Im Folgenden möchte ich den Blick nur auf die Forschungstätigkeit richten.
Anders als bei Studierenden genügt es bei Promovierenden natürlich nicht, in ihren wissenschaftlichen Texten bestehendes Wissen nur zu reproduzieren oder neu zu arrangieren. Von ihnen wird ein Erkenntnisfortschritt erwartet. Sie „tun nicht mehr so als ob“ wie beim Schreiben von Haus- und Abschlussarbeiten, sondern sie sind dabei, sich in die Wissenschaft einzubringen. Die in Bezug auf studentische Arbeiten oft gestellte Frage „Wo ist denn da die Eigenleistung!?“ bleibt hier aus, da eben diese Eigenleistung eine Bedingung für die erfolgreiche Promotion ist.
Mir ist nicht bekannt, dass die neuen KI-Möglichkeiten Diskussionen zur grundlegenden Neugestaltung der Promotion ausgelöst haben. Die beiden grundsätzlichen Möglichkeiten, die Promotion als Monographie oder in kumulativer Form zu veröffentlichen, bestehen weiterhin. Was wäre auch die Alternative zur Textform in der Wissenschaft?
Letztlich sind Promovierende darauf angewiesen, dass ihre Arbeit anerkannt wird. Dies geschieht zum einen durch das Erfüllen der internen Anforderungen, das in der die Annahme der Arbeit durch die entsprechenden Gutachter:innen und Kommissionen in der Hochschule mündet. Zum anderen sind unter Umständen zusätzlich auch externe Anforderungen zu erfüllen, wenn Artikel in den relevanten Journals platziert werden sollen. All diese Anforderungen wandeln sich gerade – gleichzeitig, aber in unterschiedlichem Tempo und Ausmaß.
Gerade weil die Eigenleistung zentral ist, wiegt die im nächsten Abschnitt beschriebene Unsicherheit beim KI-Einsatz für Promovierende besonders schwer.
Die Gegenwart: KI-Vorgaben verunsichern Promovierende
Für aktuell Promovierende bedeutet das in Hinblick auf die KI-Nutzung, dass sie flexibel nach höchst unterschiedlichen Vorgaben arbeiten müssen. (Hier geht es um deutlich mehr als das Einbauen von Zitaten des zweiten Gutachters, um dessen Stimmung bei der Lektüre der Arbeit aufzuhellen). Hochschulen ringen noch um einen guten Umgang mit KI und die Aussagen unterscheiden sich je nach Ebene, wenn sie sich nicht sogar widersprechen: So sind schriftlich fixierten Regelungen der Universität oder auch die inoffiziellen „KI-Schwingungen“ mitunter andere als jene Fakultät, wovon sich wiederum die persönliche Ansicht und Vorlieben von Doktormutter oder -vater unterscheiden mögen. Zudem sind die Richtlinien der Journals zu beachten. Auch diese unterscheiden sich voneinander. An dieser Stelle braucht es die Fähigkeit zur Anpassung, ohne sich zu verlieren.
Als das trifft Promovierende in einer Phase, in der das wissenschaftliche Selbstbewusstsein meist noch nicht besonders stark ausgeprägt ist, um es einmal vorsichtig zu formulieren. Wie oft stellen Promovierende ihre Arbeit und auch sich selbst in Frage? Wenn dann auch noch das Umfeld wackelig erscheint, kann es schwierig werden.
Die Lösung sind übrigens nicht einheitliche Vorgaben. Denn Menschen können sich an neue Situationen anpassen und auch mit unterschiedlichen Vorgaben umgehen. Sie brauchen dazu die Qualitäten des wissenschaftlichen Chamäleons. Es wechselt die Farbe und bleibt dennoch ein Chamäleon. Dieser Vergleich lässt sich am besten erläutern, wenn wir ein wenig in die Zukunft denken.
Die Zukunft: KI bei der Promotion nutzen, ohne sich unsichtbar zu machen
Wie ein Chamäleon können wir Menschen lernen, uns flexibel an die Umgebung anzupassen. In diesem Kontext bedeutet das: Wir können 1) uns auf neue Werkzeuge wie KI einstellen und 2) diese je nach Bedarf auch in unterschiedlichem Maße in unseren Arbeitsprozess einbinden. Entscheidend ist, dass wir auch bei starker KI-Nutzung nicht völlig in den Tools aufgehen und sie nicht anstelle des eigenen Denkens verwenden. Wir müssen als Mensch im Prozess involviert und im Produkt sichtbar bleiben. Das kann beispielsweise bedeuten, dass KI bei der Literaturrecherche assistiert, aber der Mensch die zu verwendenden Quellen bewertet und auswählt. Das bedeutet außerdem, dass wir unsere eigene Stimme im Text zeigen und (als Promovierende) auch Zeit darauf verwenden, diese zu entwickeln, anstatt in KI-Sprech zu verfallen.
Für künftige Promovierende halte ich es für wünschenswert, dass sie wie ein Chamäleon die Farbe wechseln können und dabei eben nicht gänzlich unsichtbar werden. Dies entspricht dem Nutzungsszenario „Metakognitiv durchdrungene Nutzung von KI“ von Isabella Buck, die als Erweiterung des menschlichen Denkens gelten kann und eben nicht nur als Unterstützung und Entlastung oder gar als Ersatz (Buck 2025: Wissenschaftliches Schreiben mit KI: 761 ff.)
#kAIneEntwertung!
All das führt mich zu dem Schluss, dass die eigene Leistung nicht entwertet, sondern im Gegenteil aufgewertet wird.
Über kurz oder lang wird der Anspruch an wissenschaftliche Arbeiten steigen. Der Blick zurück zeigt: Was vor einigen Jahrzehnten als Promotion „durchging“, kann heute teilweise kaum noch als erste Abschlussarbeit gelten. (Das soll nicht die Leistung schmälern, die Voraussetzung waren einfach anders). Wir werden in Zukunft beispielsweise mit Hilfe von KI mehr Literatur verarbeiten und mehr Daten analysieren bzw. tiefer in die Analyse hingehen können.
Haben wir bisher, wenn neue Technologien verfügbar wurden, von einer Entwertung der menschlichen Leistung gesprochen? Ich denke nicht. Vielmehr haben wir den Fortschritt dankend angenommen. Niemand möchte heutzutage noch mit der Schreibmaschine tippen oder Regressionen mit vielen Datenpunkten händisch berechnen. Die Nutzung von Computern und Software schmälert nicht die menschliche Leistung.
Ja, ich räume ein, dass KI deutlich mehr tut, als nur den Arbeitsprozess zu erleichtern. Sie kann eine Art „Eigenleben“ entwickeln (auch wenn sie natürlich ganz und gar nicht lebt) und viel tiefer in unseren Arbeitsprozess eingreifen als bisherige Neuentwicklungen. Soll das aber nun das Argument sein, dass der KI-Einsatz die menschliche Leistung entwertet? Wertet er sie nicht eher auf, weil wir Menschen auch das noch beherrschen? Wissenschaftliches Arbeiten wird anspruchsvoller, weil wir Menschen durch die Existenz von KI-Tools in Zukunft mehr können müssen, nicht weniger. In diesem co-kreativen Prozess müssen wir ähnlich wie beim Schreiben in einem Autor:innen-Team mehr aushandeln und aushalten, als wenn wir allein einen Text verfassen.
Es geht also nicht nur darum, dass Technologien Arbeitsprozesse erleichtern, sondern dass die Bewertungsmaßstäbe mitwachsen. Das entspricht einer Aufwertung.
Was können Promovierende tun, um zum wissenschaftlichen Chamäleon zu werden?
Ich möchte nicht mit einer Tipp-Sammlung enden, sondern den Rat auf einer allgemeinen Ebene belassen: Zur Promotion gehört nicht nur die Auseinandersetzung mit fachlichen und methodischen Fragen, sondern auch das Nachdenken über den eigenen Arbeitsprozess, insbesondere über das KI-gestützte Verfassen von Text.
Die Autorin
Dr. Andrea Klein arbeitet als Dozentin, Coach und Autorin für wissenschaftliches Arbeiten. Sie ist Gründungsmitglied und Mitglied im Kernteam des VK:KIWA.
Danke
Danke an Sarah Schott für die Idee, mit dem Chamäleon-Vergleich zu arbeiten!
KI-Disclaimer (auch wenn ich ihn nicht für zwingend nötig erachte :))
Die Idee für den Text, dessen Aufbau und Inhalt stammen von mir. ChatGPT war mir in der Feedback- und Überarbeitungsphase behilflich. Ebenso wurde das Bild von ChatGPT generiert.
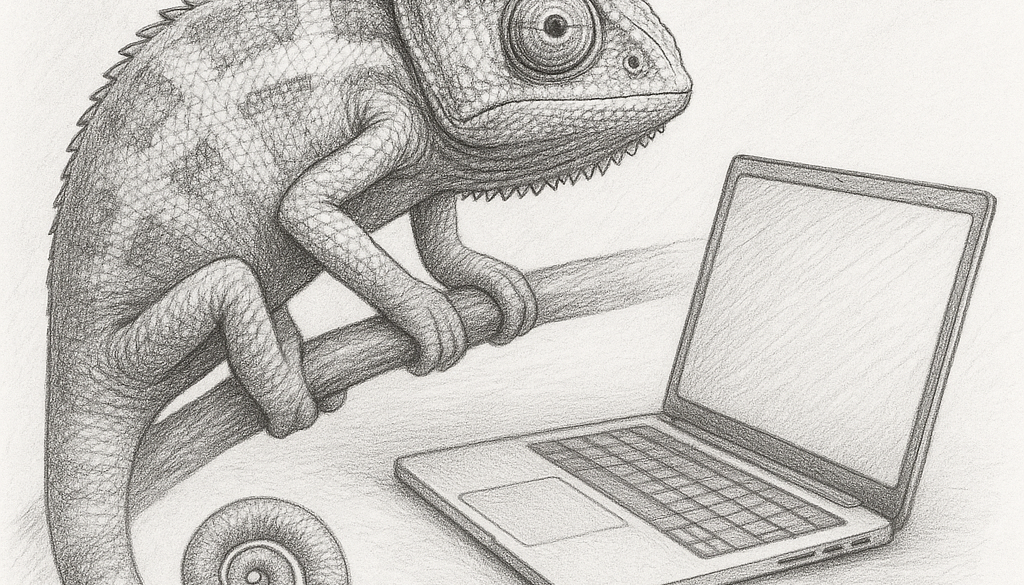

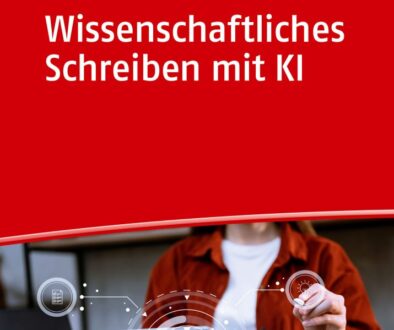

Blogparade #kAIneEntwertung |
1. Oktober 2025 @ 22:03
[…] Dr. Andrea Klein schreibt über die Chamäleon-Kraft in der Promotionsphase – KI nutzen, ohne unsichtbar zu werden: https://www.einfach-wissenschaft.de/chamaeleon/ […]