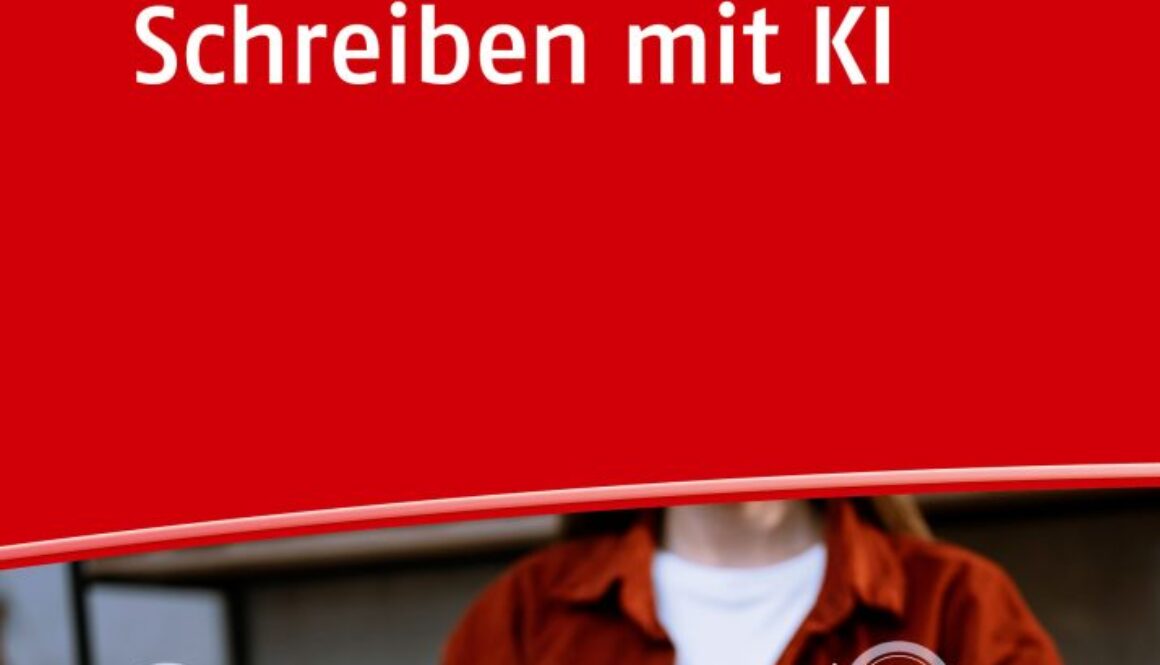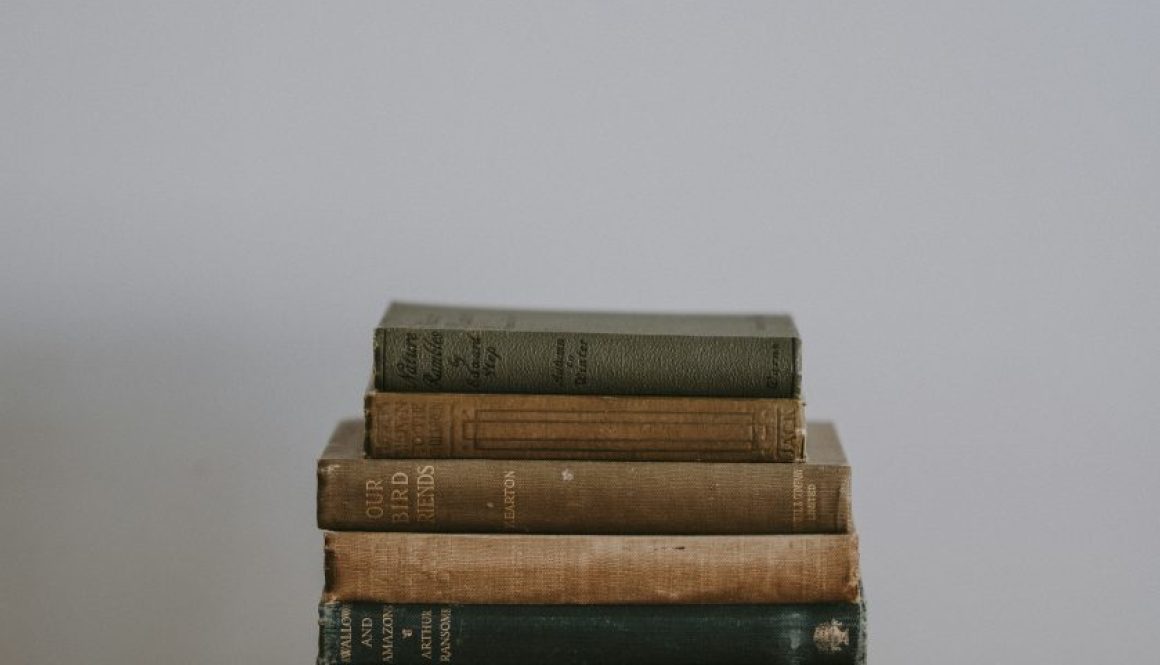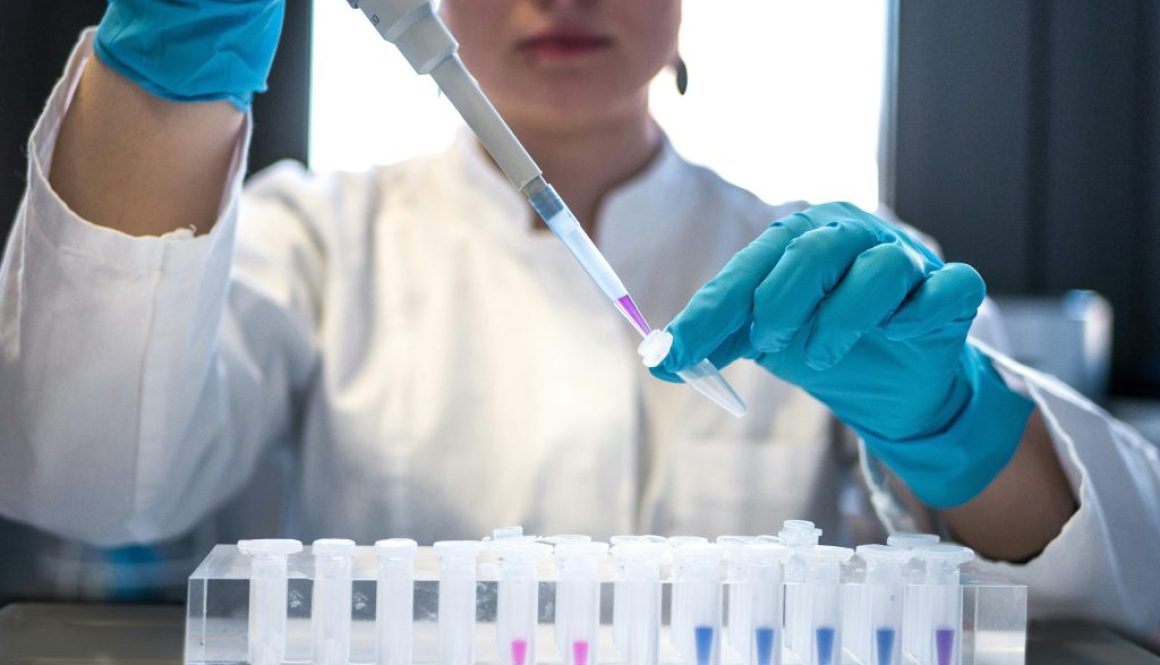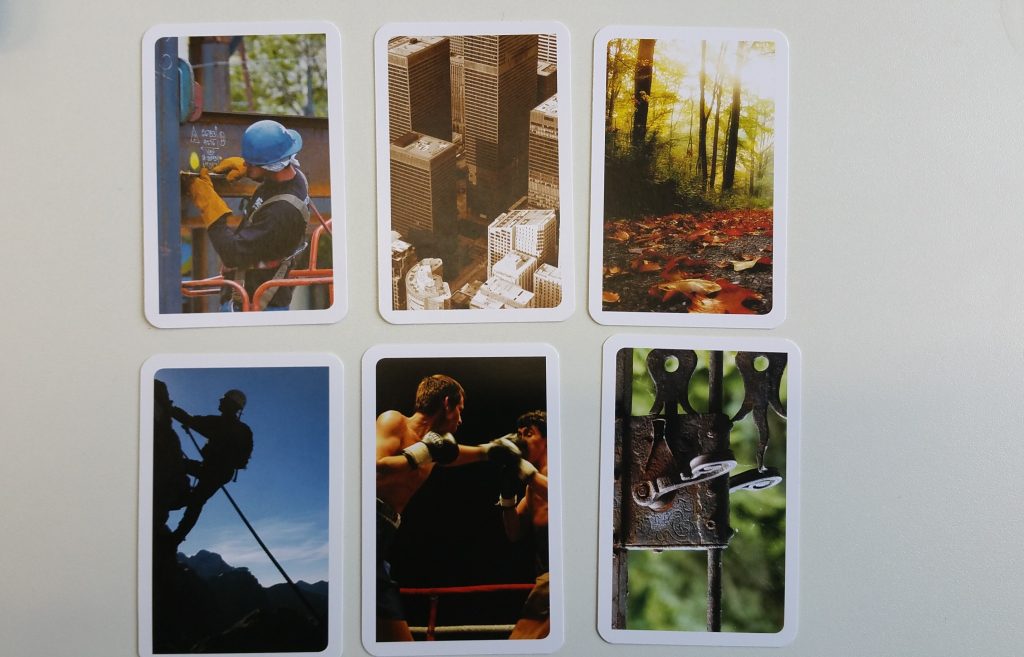Buck: KI-Enthusiasmus, der mitreißt
Dieser Artikel erschien erstmal am 17.03.2025 im Blog „Wissenschaftliches Arbeiten lehren“ und wurde für die Veröffentlichung bei „einfach wissenschaft“ aktualisiert und geringfügig angepasst.
Buck, Isabella (2025): Wissenschaftliches Schreiben mit KI. Stuttgart: UTB/UVK.
22,90 Euro
242 Seiten
Inhaltsübersicht:
1 Worum es in diesem Buch geht
2 Was ich über KI wissen sollte
3 Was ich über das wissenschaftliche Schreiben mit KI wissen sollte
4 Wie ich mit KI wissenschaftlich schreibe
5 Wohin die Reise (vielleicht) gehen wird
Buck: KI-Enthusiasmus, der mitreißt
Dieses Buch hat gefehlt. Es ist ein 242 Seiten starkes Gegenargument zu der oft gehörten Behauptung „Das steht doch alles im Internet!“ Sicher kann man sich dieses Wissen irgendwie im Internet zusammensuchen. Solider (und bequemer!) bildet man sich allerdings mit dem Buch fort.
Dr. Isabella Buck leitet an der Hochschule RheinMain das Competence & Career Center und arbeitet zudem freiberuflich als Trainerin, Dozentin sowie als Schreibberaterin. Sie ist zudem – das sei der Transparenz halber erwähnt – eine VK:KIWA-Kollegin von mir, wir sind beide Mitglied des Kernteams. Ich durfte außerdem zu Teilen des Buchmanuskripts Feedback geben.
Wie ist das Buch aufgebaut?
Die Inhalte des Buchs sind in fünf Kapitel aufgeteilt, die entweder klassisch der Reihe nach gelesen oder aber nach dem individuellem Bedarf ausgewählt werden können. Zahlreiche Querverweise erleichtern dabei die Orientierung. Das einleitende Kapitel „Worum es in diesem Buch geht“ enthält viele Hinweise, wie man den größten Nutzen aus der Lektüre ziehen kann.
Ganz ohne Hintergrundwissen über die Eigenschaften und auch Eigenheiten von KI-Tools geht es natürlich nicht, diese sind in Kapitel 2 auf wenigen Seiten gut lesbar und verständlich aufbereitet. Dafür werden zunächst die Begrifflichkeiten geklärt, dann die generell Funktionsweise erklärt, um anschließend auf Halluzinationen und die lange Reihe anderer Herausforderungen einzugehen.
In Kapitel 3 ist die Vorbereitung des wissenschaftlichen Schreibens mit KI dran: Wie sollten sich Mensch und Maschine die Arbeit teilen? Was ist im Sinne guter wissenschaftlicher Praxis vertretbar? Wie wähle ich überhaupt ein geeignetes KI-Tool aus, wie instruiere ich es?
Kapitel 4 ist fraglos der Kern des Buches. Es umfasst etwa die Hälfte des Umfangs und behandelt die den vermutlich interessantesten Aspekt, wie sich denn nun KI vorteilhaft verwenden lässt. Hier erfahren die Leser:innen sehr konkret, wofür sie welche Tools wie einsetzen können. Es reicht von den Vorüberlegungen und Planungen über die Literaturarbeit bis zur Datenerhebung und -auswertung (dazu weiter unten mehr) und schließlich zur Rohfassung und zum Überarbeiten.
Die Kapitelüberschrift „Wie ich mit KI wissenschaftlich schreibe“ ist durchaus auch in einem anderen Sinn zu verstehen – wir bekommen nämlich auch tiefe Einblick in Isabella Bucks Schreibprozesse mit KI. Wir dürfen bei einer höchst anspruchsvollen Art der Umsetzung zusehen, nämlich wie KI nicht als Ersatz, sondern als Erweiterung des menschlichen Denkens genutzt wird (S. 82). Die Autorin geht hier also als Vorbild voran, sie schreibt dazu an späterer Stelle: „In Kapitel 4 habe ich Ihnen recht detailliert Möglichkeiten aufgezeigt, wie Sie KI-Tools gewinnbringend in Ihren Schreibprozess integrieren können. Ich stehe hinter diesen Möglichkeiten und greife selbst regelmäßig darauf zurück, wenn es für die jeweilige Teilaufgabe im Schreibprozess angemessen ist. Und ja, ich möchte die Vorteile, die generative KI für mein wissenschaftliches Schreiben bietet, nicht mehr missen.“ (S. 219) Damit ist die Grundhaltung, die dieses Buch so wunderbar trägt, zusammengefasst.
Das Buch endet mit dem fünften Kapitel in einer Zeitreise bestehend aus utopischen und dystopischen Gedanken, die manche schon von dem Diskussionspapier „Zehn Thesen zur Zukunft des Schreibens in der Wissenschaft“ kennen werden.
Was mich anspricht
So ziemlich alles.
Ja, das kann ich guten Gewissens so ausdrücken.
Die Inhalte sind wichtig, durchdacht und fundiert. Isabella Buck hat zudem einen guten Weg gefunden, dass das Buch nicht direkt wieder veraltet. 1) Sie schreibt über allgemeingültige Herangehensweisen an das Schreiben. So betont sie beispielsweise die Rekursivität bzw. Iterativität des Prozesses und wird außerdem nicht müde, auf die Potenziale des Schreibens für die fachliche und persönliche Entwicklung aufmerksam zu machen. Das ist wichtig, auch und gerade in der heutigen Zeit. 2) Auf die Gefahren des KI-Einsatzes wird bei allem Enthusiasmus beständig hingewiesen. Man kann es nicht oft genug erwähnen, wo die Grenzen der Tools liegen. Diese Grenzen sollten uns auch bei weiterem technischen Fortschritt stets bewusst sein. Und 3) Die Autorin schildert realistische Einsatzzwecke im Detail und gibt Beispiele. Das wird sich gut auf spätere Versionen von KI-Tools übertragen lassen, weil man die Begründungen und Erläuterungen gut nachvollziehen kann.
Mich persönlich bestätigt das Buch in dem, was ich in Workshops selbst lehre: „Mensch mit Maschine“ und nicht „Maschine statt Mensch“. Gleichzeitig war es auch inspirierend. Ich habe selbst durchaus noch einiges dazugelernt und freue mich aufs Testen! Denn dem folgenden Zitat stimme ich zu 100 Prozent zu: „KI-Tools sind ein wunderbares Hilfsmittel, um sich schrittweise dem finalen Text anzunähern. Sowohl durch Ihr eigenes Schreiben als auch durch die Interaktion mit KI-Tools können Sie sukzessive entdecken, was genau Sie zum Ausdruck bringen möchten.“ (S. 188)
Was mir nicht gefällt
Womit ich immer wieder hadere, ist der weite Begriff des Schreibens, der nicht nur alle schreibvorbereitenden Tätigkeiten sowie das Schreiben selbst und das Überarbeiten umfasst, sondern z. B. auch das Erheben und Auswerten von Daten (das sollte wissenschaftliches Arbeiten genannt werden, finde ich). Diese Rezension ist jedoch nicht die geeignete Gelegenheit, um dies auszubuchstabieren. Vielmehr freue ich mich sehr, dass endlich, endlich aus schreibdidaktischer Expertise heraus ein solches Buch entstanden ist. Wie eingangs geschrieben: Dieses Buch fehlte.
Ansonsten gibt es nur sehr wenige Stellen, an denen ich andere Erfahrungen gemacht habe oder die Sache anders angehe. Das hat mich irritiert, aber das darf es ja auch. Dafür lese ich.
Welchen Studierenden kann man das Buch empfehlen?
Die Zielgruppe des Buches sind Studierende und Promovierende aller Fachbereiche mit ersten Erfahrungen beim wissenschaftlichen Arbeiten, äh pardon, beim wissenschaftlichen Schreiben. 😉 An den entsprechenden Stellen sind jeweils Hinweise auf das nötige Vorwissen angebracht, so dass sich Lesende vorab fragen können, ob sie KI-Tools überhaupt kompetent einsetzen können. Um Ihnen einen Einblick zu geben: Bei Kapitel 4.3, Literaturarbeit, bestünde das nötige Vorwissen beispielsweise in „Kriterien für zitierfähige und zitierwürdige Literatur, Qualitätskriterien für zitierte Literatur, Fachspezifische Zitierkonventionen, Kenntnis über verschiedene Lesestrategien, abhängig vom Leseziel, Kompetenz, die gefundene Forschungsliteratur sinnvoll weiterzuverarbeiten“ (S. 151).
Was bringt das Buch für den Einsatz in der Lehre?
Für Lehrveranstaltungen zum wissenschaftlichen Arbeiten ist das Buch nicht konzipiert. Dennoch werden Lehrende, die in ihren Veranstaltungen über das Schreiben sprechen möchten, zahlreiche Anregungen erhalten, wie sie und ihre Studierenden KI-Tools schreibförderlich und verantwortungsvoll einsetzen können.
Weiterführender Link
Zum Blog von Dr. Isabella Buck: https://isabella-buck.com/blog/
Herzlichen Dank an den Verlag für das Rezensionsexemplar!