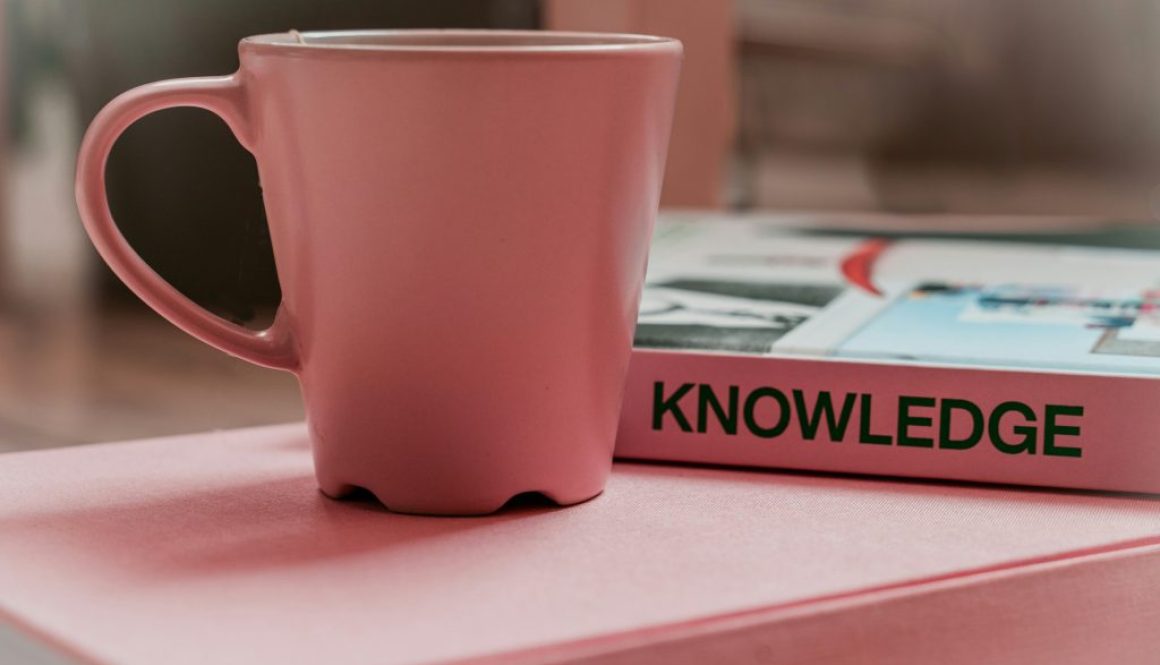Alltagswissen und wissenschaftliches Wissen
Sitzt Du manchmal beim Schreiben Deines wissenschaftlichen Texts und denkst Dir bei einer bestimmten Aussage: „Das weiß man doch. Das IST einfach so!“ Trotzdem suchst Du händeringend Quellen, weil Dir irgendwer gesagt hat, dass Du alles, einfach alles, belegen musst, was in Deiner Arbeit steht. Sonst wäre das ja schließlich nicht wissenschaftlich.
Stopp!
Das stimmt so gar nicht. Du musst gar nicht alles belegen. Es gibt Ausnahmen. Aber darauf kommen wir später zurück.
Denn erst einmal solltest Du verstehen, was der Unterschied zwischen Alltagswissen und wissenschaftlichem Wissen ist. Denn sonst verstehst Du auch nicht, was Du mit Quellen belegen musst und was nicht.
Ein Beispiel für Alltagswissen
Ich gebe es zu, manchmal bin ich etwas verfressen. Da darf es dann gern etwas Süßes sein, wie beispielsweise eine Schokolade (gern in die Richtung Salted Caramel, aber eine ganz schlichte Zartbitterschokolade kann auch sehr fein sein!).
Wenn ich jetzt aufgrund meiner Erfahrungen sage
„Schokolade macht glücklich.“,
ist das Alltagswissen. Denn nach dem Essen der Schokolade habe ich meist ein Gefühl von Glück verspürt. Oft auch schon in Vorfreude auf die Schokolade oder aber natürlich während ich die Schokolade esse. Diese Erfahrung hast Du wahrscheinlich schon gemacht.
Nehmen wir das anhand eines anderen Szenarios noch etwas mehr auseinander:
Stell Dir eine Situation vor, in der es Dir nicht besonders gut ging. Aber mit einer Tafel leckerer Schokolade sah die Welt gleich schon ganz anders aus. Als es Dir das nächste Mal wieder nicht gut ging, hast Du wahrscheinlich wieder zur Schokolade gegriffen. Irgendwann kamst auch Du zu dem Schluss: „Schokolade macht glücklich.“.
Noch mal stopp!
Es kann sein, dass der Satz „Schokolade macht glücklich.“ stimmt. Es kann aber auch sein, dass er nicht stimmt. Oder nur manchmal.
Auf dem Weg zum wissenschaftlichen Wissen
Bei einer wissenschaftlichen Herangehensweise würden deswegen u.a. die folgenden Fragen auftauchen:
- Welche Schokolade? Wie viel davon?
- Was heißt „glücklich“ genau? Wie kannst Du das erfassen? Welches Level muss erreicht sein?
- Wie lange muss dieser Zustand des Glücklichseins anhalten, damit er zählt? Nur während Du die Schokolade isst oder auch danach?
- Hat nicht vielleicht etwas Anderes Dich in dem Moment glücklich gemacht? Wäre es Dir vielleicht auch ohne die Schokolade besser ergangen?
- Gilt der festgestellte Zusammenhang für alle Menschen? Ist er demnach verallgemeinerbar? Oder für wen gilt er nicht? Oder unter welchen Umständen gilt er nicht?
Du siehst, „die Wissenschaft“ kann eine ganz schöne Spielverderberin sein. Alles wird genau hinterfragt und – in vielen Wissenschaftszweigen – auch versucht, messbar zu machen.
Moment mal, heißt das, alles kann irgendwie wissenschaftliches Wissen sein?
Irgendwie schon!
Es gibt keine Aufteilung anhand inhaltlicher Kriterien, die uns sagt „Das Wissen über diese Inhalte ist auf jeden Fall Alltagswissen, und bei Wissen über jene Inhalte handelt es sich immer um wissenschaftliches Wissen.“ Die Gleichungen „Wissen über Katzenbabies = Alltagswissen“ und „Wissen im Bereich Astrophysik = wissenschaftliches Wissen“ gehen also nicht auf. So gut wie alles kann Gegenstand des wissenschaftlichen Arbeitens sein, muss es aber nicht. Denn das Alltagswissen hat ja seine Berechtigung. Es hilft uns dabei, gut durchs Leben zu kommen.
Der wissenschaftliche Arbeitsprozess
Wissenschaftliches Wissen ist hoch angesehen, denn es handelt sich dabei um eine besonders „belastbare“ Art von Wissen. Zunächst entsteht es in einem systematischen Prozess der Erkenntnisgewinnung, zudem wird es immer wieder geprüft und von allen Seiten kritisch beäugt.
Wie sieht nun also dieser wissenschaftliche Prozess ganz konkret aus? Auf welchem Weg kommen wir zu wissenschaftlichem Wissen? Und was heißt das für Dich?
Fangen wir doch einfach vorne an.
Die gute wissenschaftliche Praxis verlangt es, dass Du Dich auf den Stand der Forschung beziehst (QUELLE DFG). (Bitte lasse Dich von diesem Anspruch nicht abschrecken, wenn Du gerade Deine allererste Hausarbeit schreibst. Da nimmt das bei der Bewertung kaum jemand als Messlatte. Je weiter Du dann auf das Ende Deines Studiums und auf die Abschlussarbeit zugehst, desto wichtiger wird das.) Betreibe so oder so eine gründliche Literaturrecherche.
Wie kannst Du die oftmals unüberschaubare Zahl der Quellen beherrschen? Ein Literaturverwaltungsprogramm ist hier oftmals der Schlüssel. Darin kannst Du die Quellen sauber ablegen, sie durchsuchen und für das Zitieren vorbereiten.
Anders als beim Alltagswissen musst Du Dich, wenn Du wissenschaftliches Wissen festhältst, auch auf das zugrundeliegende Wissen beziehen. Dies geschieht in Form von Zitaten. Während Du im Fall von Alltagswissen einfach sagen kannst „Ich habe das aber schon x-mal so erlebt!“ oder „Tante Trudi sagt das auch.“, brauchst Du beim wissenschaftlichen Arbeiten die Unterstützung in Form von möglichst angesehenen Quellen. Deine eigenen Argumente zählen einfach mehr, wenn Du noch ein paar sauber recherchierte und aussagekräftige Quellen findest, die das Gleiche behaupten/belegen. Oder aber Du widerlegst mit Deinen Daten und Argumenten das, was bisher in den Quellen stand.
Auf das fremde Wissen musst Du Dich also beziehen. Sei es eine Monographie, ein Sammelband, oder ein Zeitschriftenartikel – fremdes Wissen musst Du immer kennzeichnen! Dabei spielen die Literaturgattung, direkte und indirekte Zitate und der (gewünschte) Zitierstil eine wichtige Rolle, die korrekt angewandt werden müssen. In meinem Guide „einfach zitieren“ findest Du konkretere Hinweise und Tipps zu diesem Thema. Grundsätzlich gilt jedoch beim Verwenden von fremdem Wissen: Zitate werden verwendet, um Deine Argumentation zu unterstützen und sollten sprachlich passend in Deinen Text eingebunden werden.
Wissen weitergeben
Beim Alltagswissen ist die Entstehung eng mit der Weitergabe verknüpft: Man unterhält sich eben über die eigenen Erfahrungen und entwickelt eine bestimmte Sicht der Dinge.
Die übliche Art, wissenschaftliches Wissen weiterzugeben, ist die Schriftform. In allen möglichen Publikationen, vor allem aber in Zeitschriftenartikeln und Büchern, werden die neuen Erkenntnisse in die Welt getragen. Dazu ist es natürlich nötig, das Schreiben zu beherrschen. Nicht von ungefähr dreht sich auf diesem Blog vieles ums Schreiben. Viel zu selten wird immer noch über den Schreibprozess gesprochen, dabei gibt es in dieser Hinsicht so wertvolle Tipps aus der Schreibdidaktik. Eine Literaturempfehlung hierfür wäre „Wissenschaftliches Schreiben mit KI“ von Dr. Isabella Buck.
Aber auch die mündliche Weitergabe spielt in der Wissenschaft eine Rolle. Auf Konferenzen kommen Wissenschaftler:innen zusammen, um ihre aktuellen Forschungsergebnisse zu berichten und um von anderen zu erfahren, woran diese arbeiten (und natürlich um Kontakte zu knüpfen). Für diese Präsentationen ist es wichtig, auf den Punkt zu bringen, welche Forschungsfragen mit welchen Methoden bearbeitet wurden und zu welchen Ergebnissen das geführt hat.
Alltagswissen zitieren – natürlich nicht!
Mittlerweile hast Du schon ganz deutlich gemerkt: Alltagswissen sollten wir in einer wissenschaftlichen Arbeit nicht zitieren. Es ist einfach eine andere Art von Wissen, die überhaupt nicht dazu dienen soll, wissenschaftliche Erkenntnisse zu gewinnen. Wir würden damit also die eigene Argumentation deutlich schwächen und das Gegenteil von dem erreichen, was wir eigentlich wollen: Unterstützung für den eigenen Text bekommen.
Außerdem ist Alltagswissen sowieso meist nicht schriftlich festgehalten oder zumindest nicht in Form von zitierwürdigen Quellen.
Achtung, Verwechslungsgefahr: Alltagswissen und Allgemeinwissen
Es klingt ähnlich, meint aber nicht das gleiche. Verwechsle bitte nicht Allgemeinwissen mit Alltagswissen.
Mit Allgemeinwissen sind Fakten gemeint. Was Du in einem Quiz gefragt werden könntest, ist meist Allgemeinwissen, also beispielsweise „Was ist der höchste Berg der Welt?“ oder „Wie heißt der aktuelle Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland?“. Das hat wenig mit den Erfahrungen und Meinungen zu tun, die das Alltagswissen bilden.
Und noch mal Achtung: fachliches Allgemeinwissen
Wissen, das in einem Fach unumstritten ist, gilt als so genanntes fachliches Allgemeinwissen. Es ist gewissermaßen die Basis, an der erst einmal nicht gerüttelt wird.
Beispiel
Ein Beispiel für fachliches Allgemeinwissen wäre beispielsweise, dass die chemische Formel für Wasser H2O ist. So etwas musst Du nicht belegen, da es innerhalb der wissenschaftlichen Community als Wissen vorausgesetzt wird.
Es kann vorkommen, dass Du Dir bei manchen Aussagen, die Du in Deinem Text triffst, nicht sicher bist, ob es sich dabei um fachliches Allgemeinwissen handelt oder nicht. Solltest Du diese Aussagen dann belegen? Im Zweifelsfall ja. Wenn Du „zu viel“ belegst, ist das nicht weiter schlimm. Wenn Du jedoch „zu wenig“ belegst, kann das unangenehmen Folgen haben. Mit der Zeit wirst Du ein Gespür dafür entwickeln.
Andere Wissensarten
Praxiswissen
Unter Praxiswissen versteht man die Erfahrungen und Routinen, die sich in der (beruflichen) Praxis über längere Zeit bewährt haben – sowohl auf individueller als auch auf struktureller und organisatorischer Ebene. Dieses Wissen basiert nicht zwingend auf wissenschaftlichen Methoden und wird auch als „berufspraktisches Wissen“ bezeichnet. Praxiswissen entsteht über Jahre durch Anwendung, Schulungen und den Austausch mit Kolleg:innen. Somit ist diese Wissensart reflektierter als zufällig entstandenes subjektives Alltagswissen, aber weniger systematisch und objektiv als wissenschaftliches Wissen.
Weltwissen
Weltwissen bezeichnet allgemeines Erfahrungswissen über Umwelt und Gesellschaft. Konkreter versteht man darunter Sachwissen über konkrete einzelne Dinge, Schemawissen über zeitliche und kausale Zusammenhänge und Wissen über sogenannte prototypische Handlungsabläufe und Rollenverteilungen. Wenn man beispielsweise sieht, dass etwas oben aus einem Topf kommt, der gerade auf dem Herd steht, geht man davon aus, dass dort das Essen überkocht. Das fällt unter Schemawissen. Zu wissen, wie ein typischer Restaurantbesuch abläuft, zählt ebenso zum Weltwissen über prototypische Abfolgen.
Orientierungswissen
Diese Wissensart ist systematisch und theoretisch geordnetes Wissen, das hilft, größere Zusammenhänge zu verstehen. Es unterscheidet sich außerdem vom anwendungsbezogenen Handlungswissen, dem Know-How, das auf die praktische Umsetzung ausgerichtet ist und dem beschreibenden Sachwissen. Ein Beispiel dafür wäre, dass angehende Ärzt:innen im Studium Orientierungs- und Detailwissen erwerben, jedoch erst durch langjährige Praxiserfahrung verantwortungsvoll handeln können.
Fazit
Halten wir also fest: Schokolade macht glücklich, Katzenbabies auch.
Im Ernst: Alles kann wissenschaftliches Wissen sein, solange es in einem systematischen Erkenntnisgewinnungsprozess entstanden ist. Zum wissenschaftlichen Text gehören Zitate, da man sich immer auf fremdes Wissen bezieht und dies angeben muss.
Wenn Du mehr wissen willst, abonniere meinen YouTube-Kanal.😊