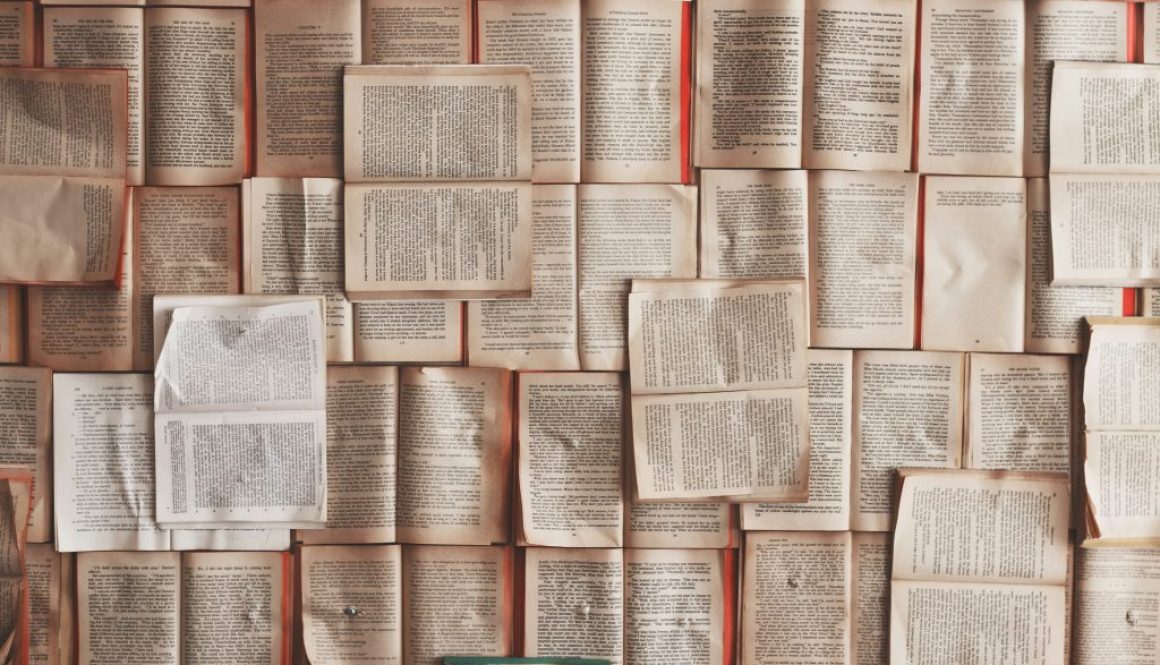Wie finde ich eigentlich gute Literatur für meine Hausarbeit?
Die Literaturrecherche ist der grundlegende Baustein für Deine wissenschaftliche Arbeit. Egal, ob Hausarbeit oder Abschlussarbeit – eine systematische Literaturrecherche ist wichtig, um gute Ergebnisse zu erzielen und eine runde Arbeit zu schreiben. Aber wo fängt man da überhaupt an? Und wie findet man geeignete (wissenschaftliche) Literatur?
Monografien, Sammelbände und Co. – Welches sind die Hauptquellenarten und wie zitierwürdig sind sie?
Fangen wir erst mal ganz von vorne an… Es ist nämlich wichtig, dass Du die Grundlagen kennst. Bevor Du mit Deiner Literaturrecherche beginnst, solltest Du verstehen, nach welchen Quellenarten Du überhaupt suchen kannst. Die folgenden Informationen helfen Dir dabei, Quellen besser einzuordnen und sie hinsichtlich ihrer Zitierwürdigkeit zu prüfen. Die Zitierwürdigkeit einer Quelle beschreibt die Eignung dieser Quelle, in eine wissenschaftliche Arbeit aufgenommen zu werden. Sie muss also wissenschaftlichen Qualitätsansprüchen genügen. Hierzu zählen beispielsweise Nachvollziehbarkeit und Zuverlässigkeit.
Die vier Hauptquellenarten, die Du bei einer Haus- oder Abschlussarbeit vermutlich verwenden wirst, sind: Monografien, Beiträge in Sammelbänden, Zeitschriftenartikel und Internetquellen.
- Monografien: Monografien sind selbständig erschienene Bücher. Sie sind in sich geschlossene Einzelwerke einer einzelnen Person oder eines Teams, das gemeinsam für das Schreiben und Veröffentlichen des Buches verantwortlich ist. Auch einzelne Bände einer Reihe sind Monografien.
- Sammelbände: Ein Sammelband ist ein von einer (oder mehreren) Person(en) veröffentlichtes Buch mit einzelnen, voneinander getrennten Beiträgen.
- Zeitschriftenartikel: Das ist ein Text von einer oder mehreren Personen, der in einer wissenschaftlichen Zeitschrift erschienen ist – meist nachdem er ein Review-Verfahren durchlaufen hat, also begutachtet wurde.
- Internetquellen: Ist die Datei oder der Text, den Du im Internet gefunden hast, auch in gedruckter Form vorhanden, so handelt es sich nicht um eine „echte“ Internetquelle und Du solltest die Quelle beim Zitieren genauso behandeln wie ein Buch oder Zeitschriftenartikel. Alles, was nicht in gedruckter Form vorliegt, zählt als „echte“ Internetquelle und muss mit URL und dem letzten Zugriffsdatum (da sich Texte im Internet schnell ändern können oder später vielleicht nicht mehr zugänglich sind) erfasst werden.
Prinzipiell kannst Du Internetquellen verwenden! Du solltest dabei nur etwas vorsichtiger sein und die Quelle genau ansehen. Prüfe, wer für die Seite verantwortlich ob die Informationen auch von anderen Quellen gestützt werden.
Wir sehen: Keine dieser Quellenarten ist per se „wissenschaftlich“ oder „unwissenschaftlich“! Nein, auch nicht Internetquellen😊
Nun verfügst Du über eine gute Grundlage für Deine nächste Literaturrecherche! Der Unterschied zwischen den Quellenarten wird übrigens auch später noch einmal interessant, wenn es ans Zitieren geht. Je nach Quellenart brauchst Du dann andere Angaben.
Vorabrecherche – Dein Weg durch den Info-Wald
Ohne Dir etwas unterstellen zu wollen: Wahrscheinlich kennst Du das Gefühl, dass sich Deine wissenschaftliche Arbeit am Anfang so anfühlt, als würdest Du vor einem riesigen Berg von Arbeit stehen und den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen?
Mach Dir keine Sorgen, das ist ganz normal und geht den meisten von uns so! Und – Du kannst Dir ganz leicht Abhilfe verschaffen. Wie, das erfährst Du hier!
Egal, ob Du schon weißt, worüber Du (ungefähr) schreiben möchtest, oder ob Du noch keine Ahnung hast, worum es in Deiner Arbeit gehen soll: Es ist immer sinnvoll, sich zunächst einen ersten Überblick über das Themengebiet zu verschaffen. Zum Beispiel kannst Du das Thema bei Wikipedia nachlesen. Was? Wikipedia? Ja, als Quelle ist Wikipedia nicht zulässig, aber als erste Informationsstelle ist es durchaus geeignet! Hier kannst Du sehen, was überhaupt alles zu diesem Themengebiet gehört und – zumindest grob – wie der aktuelle Wissenstand ist. Wenn Du Glück hast, findest Du sogar schon erste brauchbare Quellenangaben zum Thema.
Vielleicht gibt es auch Seiten aus Deinem Fachbereich, die eine gute Übersicht über verschiedene Themen aus dem Bereich bietet? Wenn ja, kannst Du diese mit Lesezeichen versehen und immer wieder darauf zurückgreifen, wenn Du vor demselben Problem stehst. Idealerweise bieten die Seiten auch einen Überblick über relevante einleitende oder umfassende Fachliteratur, die Du später in Deiner Literaturrecherche nutzen kannst! Oft findest Du auch auf der Homepage oder dem Studienführer Deines Seminars empfohlene Literatur und Zugänge zu Datenbanken zu Deinem Fach. Ein Beispiel für das Fach Geschichte wären beispielsweise EBSCO, historicum.net und Gnomon.
Hast Du schon einen Beitrag in einem Sammelband oder eine Monographie gefunden, die genau zu Deinem Thema passen? Dann wirf doch einfach mal einen Blick in die Bibliographie oder weiterführende Literatur des Werks. Dort befindet sich oft weitere hilfreiche Literatur.
Und einfach googlen? Das kannst Du auf jeden Fall machen, bevor Du an die vertiefte Recherche mit Google Scholar, den Datenbanken Deiner Hochschulbibliothek oder KI-Tools gehst. Achte jedoch darauf, dass Du dabei genau selektierst, welche Seiten für Dich wichtig und relevant sind und ob diese Seiten auch vertrauenswürdig sind bzw. korrekte Informationen bieten.
Es ist nicht förderlich, jeder Spur nachzugehen, wenn diese nicht heiß ist, sonst wird aus der kurzen Literaturvorabrecherche, bei der Du nur Dein Thema eingrenzen oder erste relevante Quellen finden wolltest, ein ganzer Urwald.
Wenn Du zum ersten Mal recherchierst: Kenne bessere Suchorte als Google!
Lass es mich so sagen: Wenn Du Delikatessen kaufen willst, gehst Du nicht unbedingt in den Discounter. Wenn Du wissenschaftliche Literatur suchst, solltest Du daher auch nicht „im normalen Internet“ recherchieren, sondern spezielle Seiten nutzen.
Ein allererster Ansatz wäre, zumindest einmal Google Scholar statt Google zu verwenden. Danach kommen dann vielleicht noch Microsoft Academic und BASE ins Spiel. Je nach Verfügbarkeit an der Hochschule hast Du auch Zugriff auf Springer Link, wiso-net und EBSCO, um nur einmal drei zu nennen. Die verlinke ich nicht, weil Du darauf am besten über Deinen Hochschul-Account zugreifst.
Für Fortgeschrittene: Mach den Vergleich!
Alles Pillepalle? Die oben genannten Suchorte waren Dir längst bekannt, und es ist Dir klar, dass das nur eine winzige Auswahl ist. Dann schau doch mal genauer hin und vergleiche bei Deiner nächsten Suche systematisch die Ergebnisse der einzelnen Suchorte. Wie das aussehen kann, zeigt Dir meine Kollegin Heike Baller in einem Blogartikel:
https://www.profi-wissen.de/vergleich-online-angebote-zur-literaturrecherche
Übrigens: Der Referenzrahmen Wissenschaftliches Arbeiten (WISAR) zeigt Dir auf einen Blick, welche Erwartungen an Dich gestellt sind, wenn es um Recherchieren und Quellenbewerten bei wissenschaftlichen Arbeiten geht. In der Dimension „Rezipieren“ findest du in den Unterkategorien 2 und 3 die einzelnen Lernschritte, denen Du Dir bewusst sein solltest, um eine gute Recherche zu betreiben und die Kriterien guter wissenschaftlicher Quellen zu kennen.
Literaturrecherche? Da gibt’s doch eine KI!
Du hast keine Lust, Dich selbst durch die oben genannten Suchorte zu kämpfen? Google Scholar liefert Dir nicht die gewünschten Ergebnisse und Connected Papers ist für Dich schon ein alter Hut? Dann gibt es hier noch ein paar interessante Tipps für KI-Tools zur Literaturrecherche! Hast Du schon mal was von Research Rabbit, Open Knowledge Maps oder Litmaps gehört? Nein? Dann ist die heutige Mail perfekt für Dich… Im folgenden Ranking erhältst Du einen kurzen Überblick über die drei Tools.
Platz 3: Open Knowledge Maps
Platz 3 ergattert sich Open Knowledge Maps (https://openknowledgemaps.org/). Über eine Schlagwortsuche erhältst Du die 100 relevantesten Quellen zum gesuchten Thema. Leider ist unklar, wie das Tool über die Relevanz der Quellen entscheidet. Oft erweckt es sogar den Anschein, als würden die ausgewählten Quellen nicht mit den tatsächlich relevanten Artikeln aus dem gesuchten Themengebiet übereinstimmen.
Die Ergebnisse werden thematisch sortiert und in einer Art Concept Map in verschieden großen Kreisen dargestellt. Die Themenkreise sind mit Schlagwörtern beschriftet, die die zugeordneten Artikel gemeinsam haben – leider sind diese nicht sehr aussagekräftig und können in verschiedensten Sprachen (je nach Quellen, keine Filtermöglichkeit) verfasst sein. Zudem erscheinen die Ergebnisse auch in einer Liste, die Du nach unterschiedlichen Kriterien sortieren lassen kannst.
Leider kannst Du Deine Ergebnisse nicht abspeichern, um später an Deiner Recherche weiterzuarbeiten. Sobald Du eine neue Suche startest, sind Deine Ergebnisse verloren. Jedoch kannst Du einzelne Ergebnisse per BibTex exportieren und in Deine Literaturverwaltungssoftware übernehmen. Open Knowledge Maps stellt auch Quellenangaben in verschiedenen Zitierstilen zu den Quellen zur Verfügung, die Du Dir herauskopieren kannst. Zudem kannst Du Dir die PDFs von Artikeln, die frei verfügbar sind, direkt auf der Seite des Tools anschauen oder herunterladen.
Platz 2: Litmaps
Mein Platz 2, Litmaps (https://www.litmaps.com/), vereint Deine Recherche und das Speichern Deiner Suchergebnisse. Du beginnst Deine Suche mit einem bestimmten Paper oder Keyword – anhand des gewählten Ausgangartikels findest Du dann schnell weitere Literatur. Denn Litmaps zeigt Dir in einem anschaulichen Graph und einer Liste Quellen, die in Deinem Ausgangsartikel zitiert werden und welche neuere Literatur diesen Artikel zitiert. Zusätzlich werden Dir auch ähnlich Quellen, die zu Deinem Thema passen könnten, vorgeschlagen. So kannst Du Dich schnell und effizient durch ein Netzwerk an Artikeln zu Deinem Thema klicken – und alle für Dich interessanten Werke mit einem Klick in Deine Map – einen Graph, der die Verbindung der Artikel zueinander aufzeigt – aufnehmen.
Litmaps bietet Dir zu vielen Artikeln Abstracts an, sowie die Möglichkeit, Artikel mit Kommentaren zu versehen. Deine Map kannst Du außerdem mit deinen Kommiliton:innen teilen und als BibTex- oder CSV-Datei exportieren. Auch der Download von frei verfügbaren PDFs funktioniert zum Teil, ist jedoch nicht ganz so intuitiv wie bei Open Knowledge Maps oder Research Rabbit.
Platz 1: Research Rabbit
Für mich der Gewinner! Warum? Research Rabbit (https://www.researchrabbit.ai/) verbindet die Vorteile von Litmaps mit einer leichten Handhabung und einer spannende Extrafunktion. Nachdem Du einen Ausgangsartikel gewählt hast, führt Research Rabbit Dich neben ähnlichen Artikeln auch zu passenden Arbeiten, die später oder früher verfasst wurden. Darüber hinaus bekommst Du auch weitere Artikel des/der Autor:in und von vorgeschlagenen Autor:innen angezeigt.
Neben den unter Litmaps genannten Vorteilen, bietet Research Rabbit Dir die Möglichkeit, das Tool mit Deinem Zotero-Account zu verbinden, so dass Du Deine Rechercheergebnisse direkt in Deine Literaturverwaltung exportieren kannst.
Wer wird Deine Nummer 1? Übrigens: Wenn Dir keins der Tools zu 100% zusagt, dann schau Dir doch mal unseren Blogartikel zu Scinapse an! Dieses Literaturrecherche-Tool verbindet Vorteile von Google Scholar mit denen der anderen genannten Tools.
Und noch ein Tipp: Wenn Du all‘ diese Dinge in Kurzfassung zur Hand haben möchtest, dann schau‘ doch mal in meinen einfach Recherchieren-Guide, dort findest du alles auf einen Blick!